
Eine Kündigungsfrist hindert sowohl Sie als auch den Arbeitgeber vor der plötzlichen Beendigung eines Arbeitsverhältnisses. Auf diese Weise haben Sie Zeit, um sich um eine neue Stelle zu bemühen. Der Arbeitgeber hingegen kann Ihre Stelle neu besetzen, ohne in der Zwischenzeit auf die Stelle zu verzichten.
Aber was genau ist die gesetzliche Mindestkündigungsfrist? Unterliegen Arbeitnehmer und Arbeitgeber den gleichen Fristen oder weichen diese voneinander ab? Im nachfolgenden Text erfahren Sie mehr dazu.
Inhalt
Kompaktwissen: Mindestkündigungsfrist
Die Mindestkündigungsfrist ist in § 622 des BGB festgelegt und bezeichnet die 4 Wochen lange Zeitspanne, die mindestens zwischen dem Ausspruch einer Kündigung und der Beendigung eines Arbeitsverhältnisses vergehen muss. Auslaufen darf die Frist entweder zum 15. oder zum Ende des Folgemonats.
Grundsätzlich ja. In einem Arbeitsvertrag haben Sie und Ihr Arbeitgeber allerdings die Möglichkeit, sich auf eine längere als eine 4-wöchige Frist zu einigen. Außerdem gibt es Tarifverträge, bei denen kürzere Mindestkündigungsfristen möglich sind. Mehr zu den Arbeitnehmerfristen finden Sie hier.
Anders als bei Arbeitnehmern, bleibt die Kündigungsfrist für Arbeitgeber in der Regel nicht unverändert und passt sich der Länge Ihrer Beschäftigungsdauer an. Mehr dazu in diesem Abschnitt.
Was ist die gesetzliche Mindestkündigungsfrist?

Kündigungsfristen sind ein Thema, das nicht jeder Arbeitnehmer immer auf dem Schirm hat. Denn wenn Sie Ihr Arbeitsverhältnis beenden möchten, müssen Sie sich in der Regel an eine gewisse Frist halten.
Haben Sie und Ihr Arbeitgeber sich im Arbeitsvertrag nicht auf eine bestimmte Frist geeinigt, müssen Sie sich laut deutschem Arbeitsrecht an die gesetzlich allgemeingültige Vorgabe halten. Doch wie lange ist die gesetzliche Kündigungsfrist?
Gemäß § 622 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) beträgt die Mindestkündigungsfrist 4 Wochen zum 15. oder zum Ende eines Kalendermonats (d. h. wenn Sie z. B. bei einer Eigenkündigung zum 15. Juni das Arbeitsverhältnis beenden möchten, müssen Sie spätestens am 18. Mai Ihre Kündigung einreichen).
Wichtig: Beachten Sie auch, dass die Mindestkündigungsfrist nicht 1 Monat sondern exakt 4 Wochen – also 4 x 7 Tage bzw. 28 Tage – beträgt. 1-Monats-Fristen sind im BGB erst ab 2 Jahren Betriebszugehörigkeit vorgesehen und betreffen im Regelfall nur Ihren Arbeitgeber.
Worauf müssen Arbeitnehmer bei der Mindestkündigungsfrist achten?

Wie lange ist die Kündigungsfrist, wenn man selber kündigt? Diese Frage ist für Sie als Arbeitnehmer besonders relevant. 4 Wochen Mindestkündigungsfrist sind zwar nach § 622 Abs. 1 des BGB üblich, aber nicht bei jedem Vertrag vereinbart.
Achten Sie daher auf die Regelungen Ihres Arbeitsvertrags, wenn Sie kündigen möchten (d. h. ob dieser sich an den gesetzlichen Vorgaben orientiert oder eigene Richtwerte für die Mindestkündigungsfrist vorgibt). Vom BGB abweichende Vereinbarungen wie Fristen von bspw. 3 Monaten zum Quartalsende sind in der Privatwirtschaft häufiger zu finden.
Wichtig: Reichen Sie Ihre Kündigung in jedem Fall schriftlich ein. § 623 des BGB bestimmt, dass mündliche Kündigungen unzulässig sind. Auch per Mail sind sie prinzipiell ungültig. Sie müssen eine Kündigung also stets in Papierform, im Original und mit Ihrem vollen Namen unterschrieben übergeben. Stellen Sie außerdem sicher, dass das Kündigungsschreiben auch tatsächlich ankommt. Es empfiehlt sich, es deshalb bei Ihrer Führungskraft oder in der zuständigen Abteilung direkt abzugeben, anstatt es per Post zu verschicken.
Wie fällt die Mindestkündigungsfrist für Arbeitgeber aus?

Kommt die Kündigung vonseiten des Arbeitgebers, hat dieser noch weitere Dinge zu beachten. Gerade die Dauer der Beschäftigung ist hier entscheidend. Je länger Sie in einem Betrieb arbeiten, desto früher muss der Arbeitgeber Ihnen Bescheid geben, wenn er Ihnen kündigen möchte.
Hier finden Sie eine Übersicht zu den Mindestkündigungsfristen für Arbeitgeber nach § 622 Abs. 2 des BGB:
| Betriebszugehörigkeit | Kündigungsfrist |
|---|---|
| bis zu 6 Monate | 2 Wochen (Kündigungszeitpunkt frei wählbar) |
| bis zu 2 Jahre | 4 Wochen zum 15. oder zum Monatsende |
| 2 bis 5 Jahre | 1 Monat zum Monatsende |
| 5 bis 8 Jahre | 2 Monate zum Monatsende |
| 8 bis 10 Jahre | 3 Monate zum Monatsende |
| 10 bis 12 Jahre | 4 Monate zum Monatsende |
| 12 bis 15 Jahre | 5 Monate zum Monatsende |
| 15 bis 20 Jahre | 6 Monate zum Monatsende |
| über 20 Jahre | 7 Monate zum Monatsende |
| Gilt nur bei Kündigung durch den Arbeitgeber. Bei Kündigung der Arbeitnehmenden gilt die gesetzliche Mindestkündigungsfrist. | |
Wichtig: Wann ist eine Kündigungsfrist von 2 Wochen zulässig? Besteht seit einiger Zeit ein Arbeitsverhältnis, gilt häufig die gesetzliche Mindestkündigungsfrist. Die Probezeit hingegen ist oft auf einen Zeitraum von 6 Monaten beschränkt. In dieser Zeit können Arbeitgeber Ihnen auch 2 Wochen vor Ihrem letzten Arbeitstag Bescheid geben, dass Sie gekündigt werden. Vertraglich lässt sich aber auch in diesem Fall eine längere Kündigungsfrist vereinbaren, sofern beide Parteien sich darüber einigen können.
Abweichungen von der gesetzlichen Mindestkündigungsfrist

Viele Unternehmen setzen die gesetzliche Mindestkündigungsfrist im Arbeitsvertrag für Angestellte als Standard. Es gibt aber Situationen, in denen andere Fristen vereinbart werden. In einigen Branchen ist es grundsätzlich üblich, dass Arbeitgeber sich auf Tarifverträge beziehen. Sind Sie als Arbeitnehmer Mitglied einer Gewerkschaft und Ihr Arbeitgeber Teil eines Arbeitgeberverbandes, sind beide Parteien sogar tarifgebunden.
Kommt bei Ihrem Vertrag ein Tarifvertrag ins Spiel, variieren auch die Kündigungsfristen. Diese dürfen nämlich von den gesetzlichen Bestimmungen abweichen. Hier sind sowohl kürzere als auch längere Fristen möglich. Anders ist es bei den regulären Arbeitsverträgen. In diesen darf lediglich eine längere, nicht aber eine kürzere als die gesetzliche Mindestkündigungsfrist festgelegt werden.
Bei tarifverträglich festgelegten Kündigungsfristen richten sich die Vorgaben auch nicht nach dem BGB sondern z. B. nach dem TVöD (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst). Dieser unterscheidet für die tarifliche Mindestkündigungsfrist auch zwischen befristeten und unbefristeten Arbeitsverhältnissen. Daraus ergeben sich gemäß § 30 und § 34 des TVöD folgende Zeiträume:
| Betriebszugehörigkeit (befristet) | Kündigungsfrist (§ 30 TVöD) |
|---|---|
| während der Probezeit | 2 Wochen zum Monatsende |
| mehr als 6 Monate | 4 Wochen zum Monatsende |
| mehr als 1 Jahr | 6 Wochen zum Quartalsende |
| mehr als 2 Jahre | 3 Monate zum Quartalsende |
| mehr als 3 Jahre | 4 Monate zum Quartalsende |
| Betriebszugehörigkeit (unbefristet) | Kündigungsfrist (§ 34 TVöD) |
|---|---|
| weniger als 6 Monate | 2 Wochen |
| mehr als 6 Monate | 1 Monat zum Monatsende |
| mehr als 1 Jahr | 6 Wochen zum Quartalsende |
| mindestens 5 Jahre | 3 Monate zum Quartalsende |
| mindestens 8 Jahre | 4 Monate zum Quartalsende |
| mindestens 10 Jahre | 5 Monate zum Quartalsende |
| mindestens 12 Jahre | 6 Monate zum Quartalsende |
Wichtig: Ein weiterer Unterschied betrifft den Geltungsbereich der im TVöD geregelten Kündigungsfristen. Denn anders als die Fristen des BGB gelten diese sowohl für den Arbeitgeber als auch den Arbeitnehmer. Sie müssen sich also bei Eigenkündigungen je nach Betriebszugehörigkeitsdauer genauso an eine längere Mindestkündigungsfrist halten.
Ende des Arbeitsverhältnisses ohne Mindestkündigungsfrist
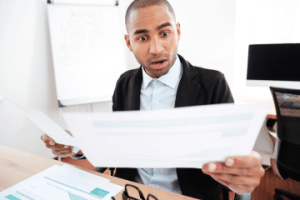
Auch wenn die gesetzliche Mindestkündigungsfrist für Sie gelten sollte, bezieht sie sich lediglich auf ordentliche Kündigungen. Diesen gegenüber stehen die außerordentlichen Kündigungen, auch fristlose Kündigungen genannt. Kommen diese zum Einsatz, bedeutet das eine sofortige Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Allerdings gilt das nur als zulässig, sofern es triftige Gründe dafür gibt.
Grundsätzlich ist es möglich, eine fristlose Kündigung ohne Mindestkündigungsfrist durchzuführen, wenn für eine oder beide Parteien die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses unzumutbar wäre.
Häufig betrifft das bspw. folgende schwerwiegende Vertragsverletzungen:
- Arbeitsunfähigkeit über einen langen Zeitraum
- Arbeitsverweigerung
- Verbale oder physische Gewalt gegenüber dem Arbeitnehmer/Arbeitgeber oder anderen Kollegen
- Diebstahl oder Sachbeschädigungen
- Arbeitszeitbetrug
- Verstoß gegen das Wettbewerbsverbot